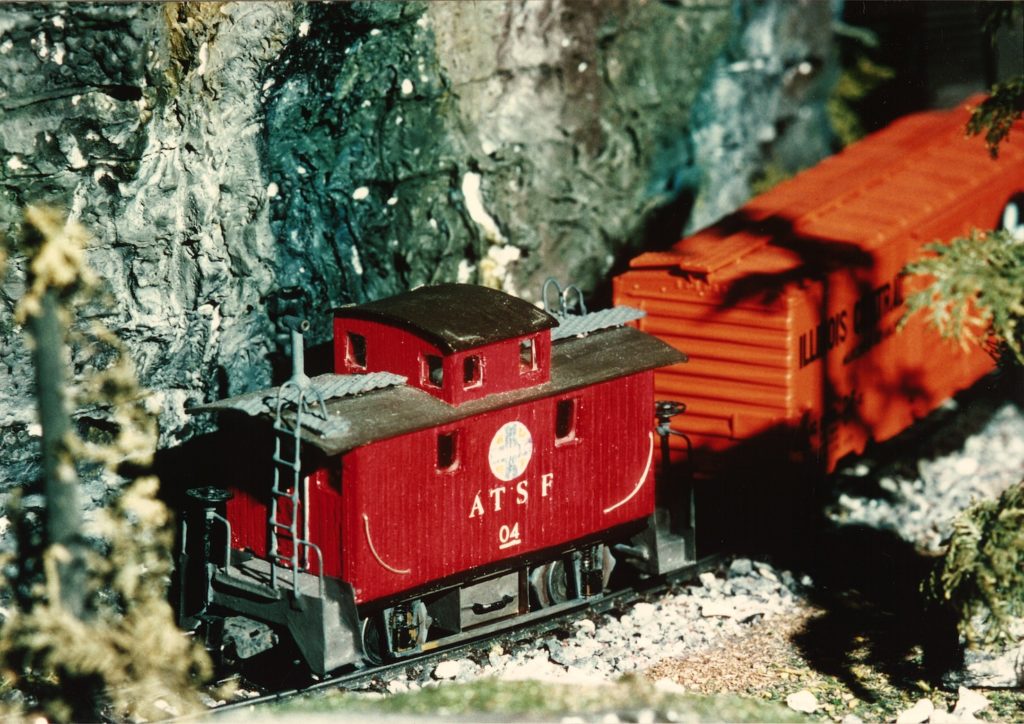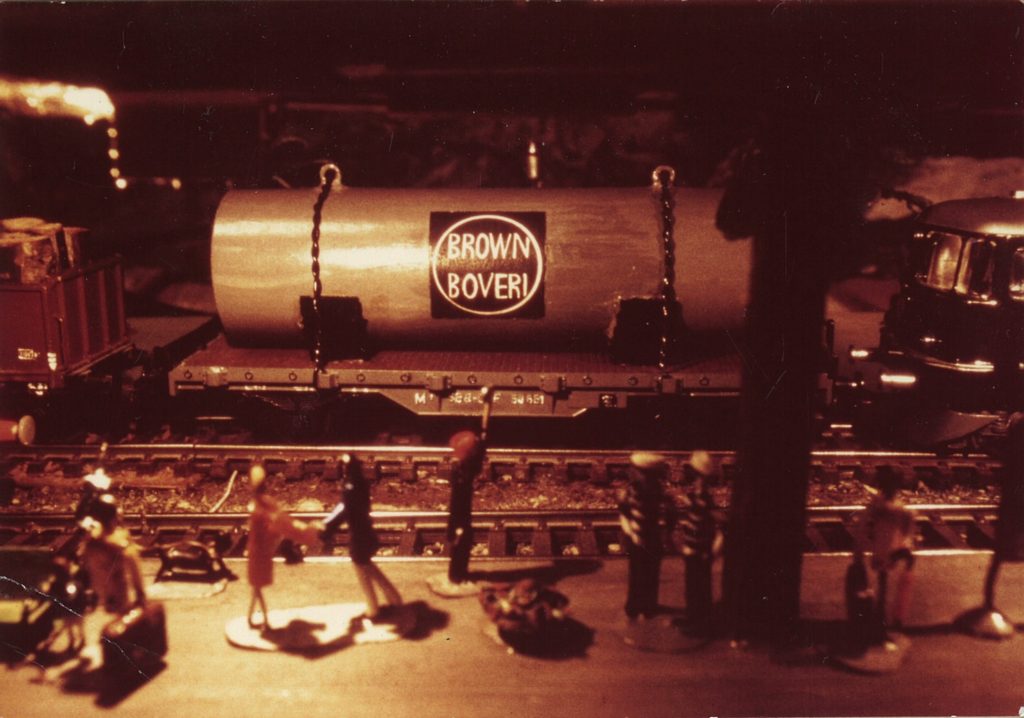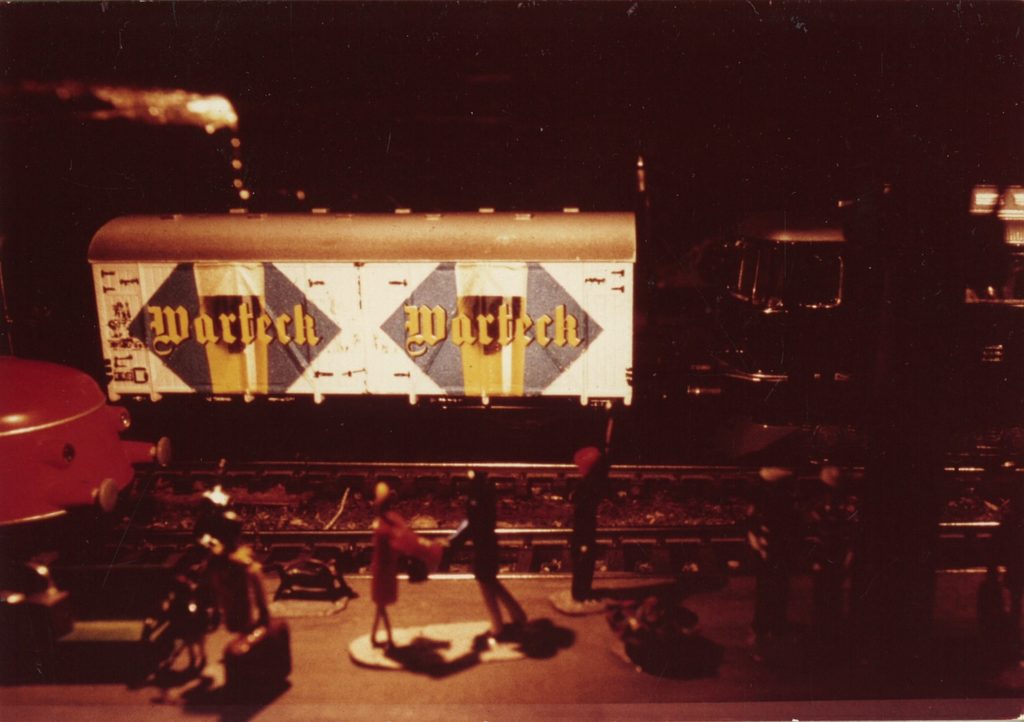IR Zürich – Konstanz auf dem neuen Nordgleis, während der Abbruch des alten Viadukts begonnen hat. 25. 9. 2017
IR Zürich – Konstanz auf dem neuen Nordgleis, während der Abbruch des alten Viadukts begonnen hat. 25. 9. 2017
Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 wird auf der IR-Strecke Zürich – Konstanz zwischen Weinfelden und Berg die 4,7 km lange Doppelspurinsel Kehlhof gebaut. Im Zuge dieses eindrücklichen Streckenausbau sind in der letzten Septemberwoche 2017 leider auch die kläglichen Reste des einst stolzen MThB-Viadukts über das Buchtobel verschwunden. Ein ausführlicherer Artikel über die Doppelspurinsel Kehlhof ist im EA 1/2018 erschienen.
 Der Buchtobel-Viadukt am 11. 6. 2017 mit Thurbo-GTW auf dem “alten” Südgleis…
Der Buchtobel-Viadukt am 11. 6. 2017 mit Thurbo-GTW auf dem “alten” Südgleis…
 Und auch der bequeme IR Konstanz – Zürich HB mit EW IV fährt am 11. 6. 2017 noch über den 107 Jahre alten Betonviadukt.
Und auch der bequeme IR Konstanz – Zürich HB mit EW IV fährt am 11. 6. 2017 noch über den 107 Jahre alten Betonviadukt.
An dieser Stelle wollen wir mit drei diesjährigen und drei alten Fotos vom Spätherbst 1996 an den kleinen Bruder des Bussnanger Viadukts erinnern und an eine Zeit, wo – irgendwie – auf der MThB alles möglich war.
 Am 16. 11. 1996 fand die Überfuhr des HzL-MAN-Triebwagenzugs (Leihfahrzeug für Radolfzell – Stockach) am Schluss von Zug 5828 Weinfelden – Engen statt. Die Aufnahme mit dem ganzen, viaduktfüllenden Zug ist im EA 2/1997 S. 90 zu finden.
Am 16. 11. 1996 fand die Überfuhr des HzL-MAN-Triebwagenzugs (Leihfahrzeug für Radolfzell – Stockach) am Schluss von Zug 5828 Weinfelden – Engen statt. Die Aufnahme mit dem ganzen, viaduktfüllenden Zug ist im EA 2/1997 S. 90 zu finden.
Der 1910 erbaute Buchtobel-Viadukt war 105 m lang und besass vier Öffnungen mit einer Weite von 23,90 m, wogegen der gleich lange Sauloch Viadukt oberhalb Kreuzlingen mit genau gleicher Länge fünf gleich grosse Öffnungen besitzt. Der berühmtere Viadukt von Bussnang hat eine Länge von 277 m und fünfzehn Öffnungen von 16,50 m, der zweitlängste Betonviadukt der früheren MThB, Jakobshöhe, mit 119 m Länge (immer zwischen den Endwiederlagern gerechnet) fünf Öffnungen von 23,90 m Weite. Alles aus dem “Schienennetz Schweiz – Ein technisch-historischer Atlas” von Hans G. Wägli abgeschrieben!
 Am gleichen 16. 11. 1996 wurde “im Gegenzug” am Schluss eines MThB-Regionalzugs aus Engen auch ein “Seehäsle”-Diesel-GTW nach Weinfelden in den Unterhalt überführt.
Am gleichen 16. 11. 1996 wurde “im Gegenzug” am Schluss eines MThB-Regionalzugs aus Engen auch ein “Seehäsle”-Diesel-GTW nach Weinfelden in den Unterhalt überführt.
Der Niedergang des Buchtobel-Viadukts begann schon in den 1990er Jahren. Durch die Rodungen im Buchtobel und die Anlage der Deponie Kehlhof/Berg war er zwar kurze Zeit noch in voller Pracht zu sehen, doch dann wurden die einst 20 m hohen Pfeiler sukzessive bis 4 – 8 m unter die Fahrbahnebene mit Aushubmaterial eingeschüttet.
 Abschiedsbild… Auch das gab’s auf der MThB: Dank der Publikation im EA 1/97 ist die Szene genau beschrieben: „Dampflok 50 245 der EFZ mit Dienstwagen BD3 und Dampflok 52 8055 auf dem Viadukt von Kehlhof am 14. November 1996. Die 52 8055 wurde anderntags zur SLM überführt und die 50 245 wurde als Zuglok für den RMT-Orientexpress eingesetzt.“ Der Nostalgie-Orient-Express des Reisebüros-Mittelthurgau (seit Saison 1993/94) und die 52 8055 sind Themen, die den Rahmen dieses Blogbeitrag über den Buchtobel-Viadukt selbstverständlich sprengen würden.
Abschiedsbild… Auch das gab’s auf der MThB: Dank der Publikation im EA 1/97 ist die Szene genau beschrieben: „Dampflok 50 245 der EFZ mit Dienstwagen BD3 und Dampflok 52 8055 auf dem Viadukt von Kehlhof am 14. November 1996. Die 52 8055 wurde anderntags zur SLM überführt und die 50 245 wurde als Zuglok für den RMT-Orientexpress eingesetzt.“ Der Nostalgie-Orient-Express des Reisebüros-Mittelthurgau (seit Saison 1993/94) und die 52 8055 sind Themen, die den Rahmen dieses Blogbeitrag über den Buchtobel-Viadukt selbstverständlich sprengen würden.
Alle Fotos: C. Ammann




 Der EA 10/2017 bietet auf S. 466 – 474 die traditionelle Vorschau auf die 15. Plattform der Kleinserie in Bauma und das Fahrzeugtreffen des DVZO.
Der EA 10/2017 bietet auf S. 466 – 474 die traditionelle Vorschau auf die 15. Plattform der Kleinserie in Bauma und das Fahrzeugtreffen des DVZO.



 Basel St. Johann 1980
Basel St. Johann 1980
 Basel St. Johann 2017
Basel St. Johann 2017 Der Blogeintrag vom 29. August löste ein Echo von Kurt Baumgartner aus. Denn bei den EMBL ist noch ein Modell eines andern Tramwagens vorhanden, das dem Ce 2/2 39 auf dem alten Foto noch etwas näher kommt:
Der Blogeintrag vom 29. August löste ein Echo von Kurt Baumgartner aus. Denn bei den EMBL ist noch ein Modell eines andern Tramwagens vorhanden, das dem Ce 2/2 39 auf dem alten Foto noch etwas näher kommt:











 De 6/6 15303 und 15301 an einem Februarsonntag 1978 in Lenzburg
De 6/6 15303 und 15301 an einem Februarsonntag 1978 in Lenzburg Der SGEG-Extrazug vor seiner Abfahrt um 10.37 an Gleis 6 in Luzern
Der SGEG-Extrazug vor seiner Abfahrt um 10.37 an Gleis 6 in Luzern Der Bahnhof Luzern 1982, also kurz vor Ausrangierung der Seetalkrokodile
Der Bahnhof Luzern 1982, also kurz vor Ausrangierung der Seetalkrokodile