Raritäten in Vevey
 Die teilweise überdeckte 16-m-Drehscheibe, für beide Spurweiten. Bild vom 13.4.2006,
Die teilweise überdeckte 16-m-Drehscheibe, für beide Spurweiten. Bild vom 13.4.2006,
Vevey erhielt 1861 seine erste Eisenbahn. Allerdings dampften am Südufer des grossen Sees die Züge schon 2 Jahre früher bis Le Bouveret, vielleicht ein Rest des Walliser Denkens zum Anschluss ans Mittelmeer via Genfersee und Rhone (vergleiche Stockalper-Kanal). 1892 wurde am nördlichen Ufer das 2. Gleis ergänzt, wobei man bereits den künftigen Transitverkehr nach Italien im Auge hatte.
Vor und um 1900 erlebten Vevey wie auch das (fast) benachbarte Montreux einen unerhörten Aufschwung. Der internationale Tourismus blühte auf, luxuriöse Hotels und viele Bergbahnen wurden gebaut. Für Vevey traf eher das Wachstum von Industrie und Gewerbe zu. 1867 begann Heinrich Nestlé mit der Produktion von Säuglingsnahrung. Heute hat der Konzern einen internationalen Spitzenplatz; dem Konglomerat unterstehen über 2000 Markennamen. Der Sitz ist immer noch in Vevey, in jenem Y-förmigen Verwaltungsgebäude, welches 1960 anstelle des früheren Grand-Hotels gebaut wurde. Letzteres dürfte mit ein Grund für die Strassenbahn zum Schloss Chillon gewesen sein, welche 1889 als erste elektrische Bahn der Schweiz in die Geschichte einging und 1956 – 1958 durch den heutigen Trolleybusbetrieb VMCV abgelöst wurde. Am gleichen Standort Vevey-Plan lagen auch eine eigene Schiffshaltestelle der CGN sowie – immer noch – die Talstation der Standseilbahn zum Mont Pèlerin (VCP, heute MVR).
In dieser Wachstumsphase wurden 1901 der Güterschuppen von Vevey, einst nördlich der SBB am Abfahrtsplatz der späteren CEV, gegen Westen verschoben, 1905 die Gleisanlagen wesentlich erweitert und 1909 ein imposantes Bahnhofgebäude errichtet. Dabei spielten die neuen Bahnstrecken nach Chamby (1902, zum Anschluss an die MOB) und Puidoux-Chexbres (1904) eine wichtige Rolle. Für die Grösse der Bahnhofgebäude von Vevey und Montreux spielte bereits die internationale Simplonlinie mit, welche damals im Bau war und 1906 eröffnet wurde.
 1987 konnte das exotische Stück noch im Original besichtigt werden. Links aussen der zusätzliche Rollwagen
1987 konnte das exotische Stück noch im Original besichtigt werden. Links aussen der zusätzliche Rollwagen
Im Norden des Bahnhofes Vevey befand sich seit jeher eine eigentümliche Gleisanlage, welche früh mein Interesse weckte. Nesté hatte hier seine Fabrikationshallen, welche mit einem normalspurigen Gleisanschluss bedient wurden. Dieser bog am nördlichsten Gütergleis (6) ab und erreichte über eine Drehscheibe das um 90o verwinkelte Anschlussgleis, wobei erst noch die 3 Schmalspurgleise der CEV zu queren waren. Diese 5,6 m lange Drehscheibe genügte für die immer länger werdenden Achsstände nicht mehr; so wurde sie um 1950 mit einem zusätzlichen äusseren Rollwagen (Originalton: chariot-satellite) des französischen Typs Marjollet erweitert, damit auch längere Güterwagen (bis 7,7 m Achsstand) transitieren konnten. Eine nochmalige Erweiterung auf äusserem Fundament erlaubte ab 1982 sogar Wagen 9 m Achsstand. Diese landesweit wohl einzige Anlage wurde schrittweise abgebaut, denn 1997 wurde hier die Zustellung abgebrochen. Im Juli 2017 wurde dieser interessante, bereits zubetonierte Anlageteil mit einem Teerbelag überzogen, womit die letzten Spuren unsichtbar wurden.
 Im Jahre 2008 war die kleine Drehscheibe bereits aufgefüllt und diente als Parkplatz.
Im Jahre 2008 war die kleine Drehscheibe bereits aufgefüllt und diente als Parkplatz.
Ein elektrischer Traktor Te 1/2, mit Baujahr 1921, besorgte das Rangieren. Nicht nur Nestlé, auch andere Firmen wurden zeitweise bedient: eine Brauerei, der Schlachthof (Vieh ab GFM ohne Umlad, weil auch schmalspurig erreichbar), die Mühle Margot. Nach 1970 wurden wegen der bekannten Reduktionen des CEV-Netzes die Schmalspurgleise überteert.
 Aufnahme von 1998
Aufnahme von 1998
Das eigenartige Rangierfahrzeug war 5,4 m lang, hatte einen Achsstand von nur 1,7 m, eine (theoretische) Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und stirnseitig eine Seilwinde (im Bild abgedeckt) mit Umlenkrollen eingebaut. Damit konnten Wagen über eine zweite Drehscheibe ins Innere der Fabrik gebracht werden.
Eigenartig sind die verschiedenen Raddurchmesser. Man verwendete (wahrscheinlich aus Kostengründen) beim Bau oder späteren Umbauten Occasionsmaterial; so kommt es, dass verschiedene Achsbüchsen (NOB und GB) zu sehen sind. Dieses eigenartige Fahrzeug leistete unter CEV-Gleichstrom von 800, später 900 Volt seinen Dienst über 75 Jahre lang, zunächst unter der Firmenbezeichnung «Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co.» und später für die Anschlussgleise im Gebiet «Ginguette». Nach seiner Ausrangierung kam es 1998 zur Vereinigung «Swisstrain» nach Le Locle, wo es 2015 in desolatem Zustand angetroffen wurde.

Bericht und alle Fotos: Ruedi Wanner
sh. auch: Bahnen an der Waadtländer Riviera,Teil 1: Einleitung und Simplonstrecke, EA 8/2007 S. 431 – 436 (traduction française pages 437 – 441) des gleichen Autors.
Fortsetzung über Vevey – Chexbres: EA 9/2007, Adhäsions-Schmalspurbahnen MOB, MVR, BC: EA 10/2007 und über die Zahnradbahnen: EA 11/2007.

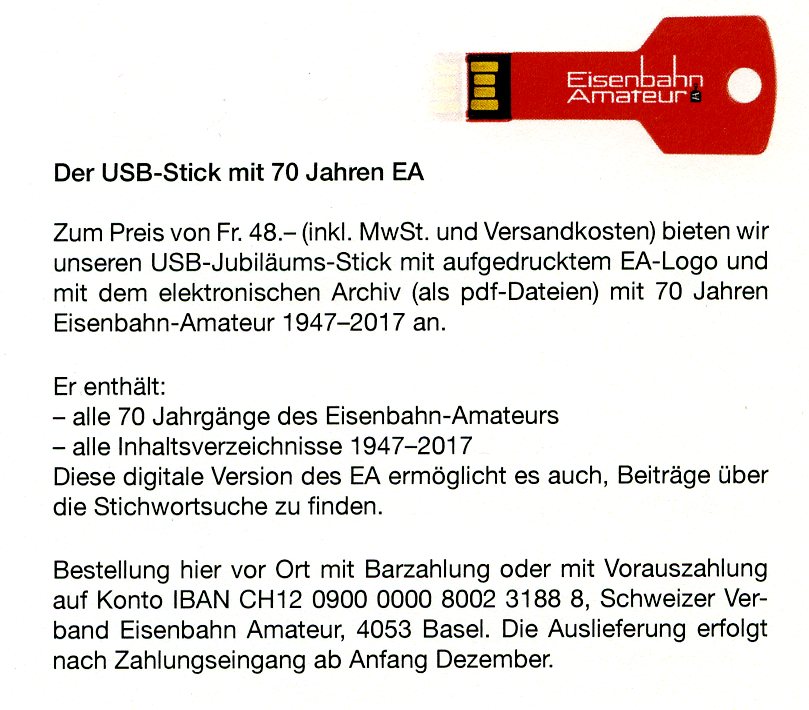
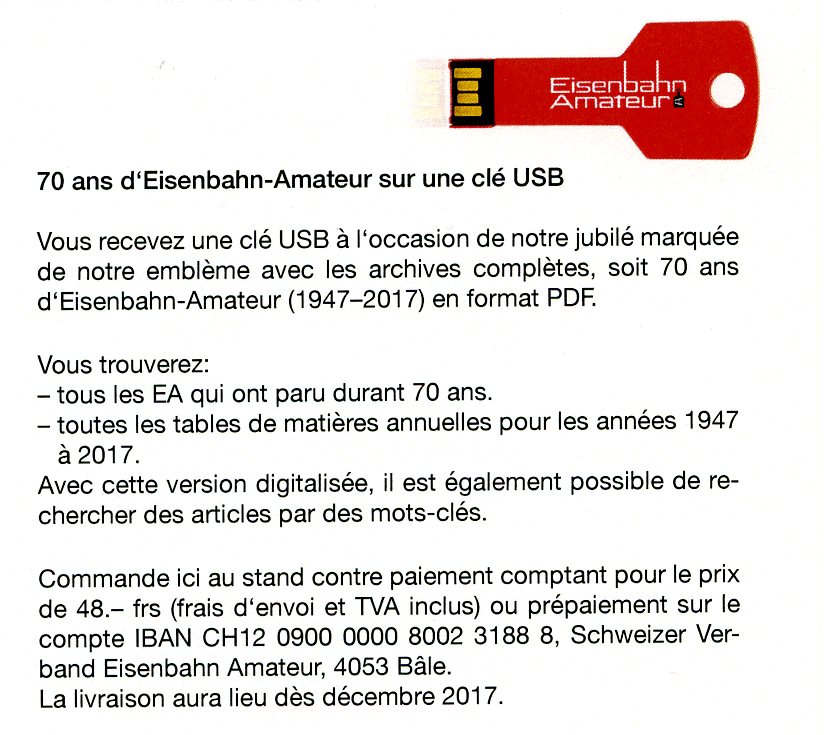







 Ansicht flussabwärts, links die «Nadeln». Das Gleis endet beim roten Kasten für den Rettungsring, Foto R..Wanner, 2. 8. 2017
Ansicht flussabwärts, links die «Nadeln». Das Gleis endet beim roten Kasten für den Rettungsring, Foto R..Wanner, 2. 8. 2017 Ansicht flussaufwärts, Schienen und Weiche. Rechts der Schuppen, links das zum Kraftwerk strömende Wasser. Foto R. Wanner, 2. 8. 2017
Ansicht flussaufwärts, Schienen und Weiche. Rechts der Schuppen, links das zum Kraftwerk strömende Wasser. Foto R. Wanner, 2. 8. 2017 Nadel-Setzgerät, das Trieb- und Arbeitsfahrzeug der Reussnadelwehr-Bahn. Foto H. Furgler, 1. 5. 2014
Nadel-Setzgerät, das Trieb- und Arbeitsfahrzeug der Reussnadelwehr-Bahn. Foto H. Furgler, 1. 5. 2014 Nadel-Setzgerät im Schuppen, Foto H. Furgler,1. 5. 2014.
Nadel-Setzgerät im Schuppen, Foto H. Furgler,1. 5. 2014. Seitenansicht des Nadel-Setzgerätes, Foto H. Furgler, 1. 5. 2014
Seitenansicht des Nadel-Setzgerätes, Foto H. Furgler, 1. 5. 2014








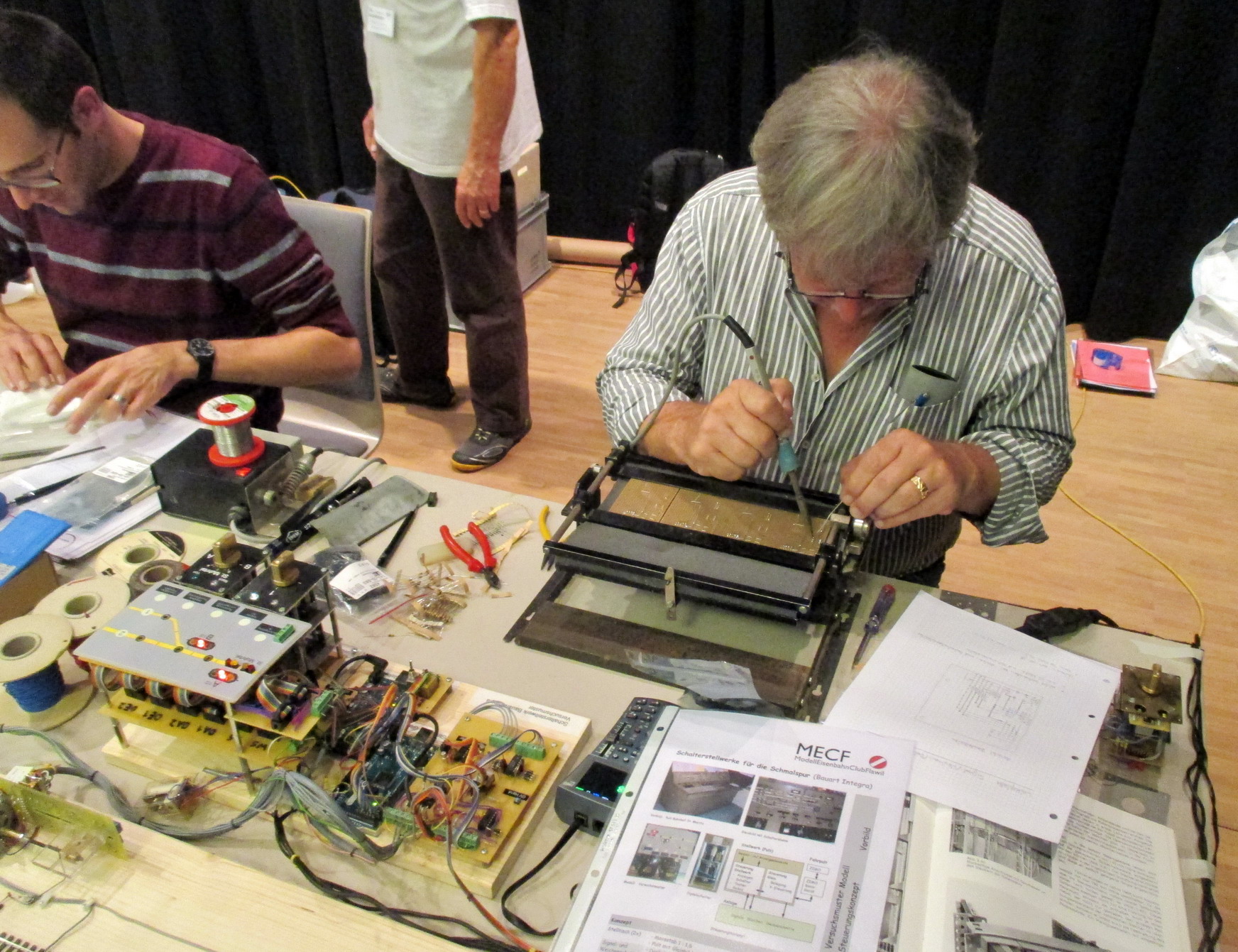














 Am 21. 9. 2017 stehen insgesamt 6 Wagen mit fabrikneuen Containern in Frauenfeld: 5 Sgns von AAE (gemietet von SBB Cargo) und 1 Sgnss von MITRAG AG. Rund 30 Jahren nach Ablösung der zweiachsigen E-Wagen durch die vierachsigen Eaos verändert sich nun ein weiteres Mal das charakteristische Bild des Zuckerrübentransports.
Am 21. 9. 2017 stehen insgesamt 6 Wagen mit fabrikneuen Containern in Frauenfeld: 5 Sgns von AAE (gemietet von SBB Cargo) und 1 Sgnss von MITRAG AG. Rund 30 Jahren nach Ablösung der zweiachsigen E-Wagen durch die vierachsigen Eaos verändert sich nun ein weiteres Mal das charakteristische Bild des Zuckerrübentransports. Beladener Containerwagen am 30. 9. 2017 in Wildegg
Beladener Containerwagen am 30. 9. 2017 in Wildegg Die Biorüben trafen in Eanos-Wagen in Frauenfeld ein.
Die Biorüben trafen in Eanos-Wagen in Frauenfeld ein. Auch das Bild des Presschnitzelversands hat sich verändert: Die grünen Ballen werden auf Flachwagen verladen. Noch werden 15% per Bahn befördert.
Auch das Bild des Presschnitzelversands hat sich verändert: Die grünen Ballen werden auf Flachwagen verladen. Noch werden 15% per Bahn befördert.